Die schöpferische Zerstörung
Evolution lebt vom Tod. Etwas Neues kann nur leben, wenn etwas Altes stirbt. Altes Leben geht, neues Leben kommt. Das gilt auch für die Wirtschaftswelt: Ideen sterben. Produkte sterben. Zielgruppen sterben. Pläne sterben. Und das ist gut so. Durch die schöpferische Zerstörung werden diese Prozesse beschleunigt, um eine schnelle Veränderung herbeizuführen.
Inhaltsverzeichnis
Lassen wir etwas nicht sterben, halten wir Neues auf
Es ist eine menschliche Grundneigung, den Tod nicht wahrhaben zu wollen. Es wird alles Mögliche unternommen, Dinge künstlich am Leben zu erhalten. Wir halten an Ideen fest, die nicht mehr zielführend sind. Wir investieren in Produkte, deren Lebenszyklus zu Ende ist. Wir halten an Beziehungen fest, die schon längst tot sind. Wir gehen weiter unserem Job nach, obwohl wir schon längst innerlich gekündigt haben. Wir bleiben auf dem sinkenden Schiff, wohlwissend, dass es sinkt. Diese Neigung hat gefährliche Auswirkungen: Lassen wir etwas nicht sterben, halten wir Neues auf. »Lebendig-Totsein« wird dieser Zustand genannt. Grenzen überschreiten ist so schlicht unmöglich.
Wachstum um jeden Preis?
In der Wirtschaftswelt sind die Glaubenssätze fest verankert, dass etwas immerzu wachsen muss. Produkte müssen immer erfolgreicher und besser werden, die Umsatzzahlen müssen jährlich steigen und die Gewinnzahlen müssen es ihnen gleichtun. »Stetiges Wachstum« ist das konstant ausgesprochene Ziel. Es muss vielmehr hinterfragt werden, wo diese Regeln herkommen. Und ob man diese Regeln brechen sollte. Bei der Regel »Wachstum um jeden Preis« fällt uns die Macht der Gewohnheit auf die Füsse. Wir denken, so müsste es sein. Und weil es so war, muss es auch in Zukunft so sein. Es sind ungeschriebene Regeln, die keine Regeln sind und eigentlich keine Daseinsberechtigung besitzen. Ein Plan, der zum Scheitern verurteilt ist, denn er ist realitätsfremd und lebensfern.
Schumpeter und die schöpferische Zerstörung
Das wusste schon der österreichische Ökonom Joseph Alois Schumpeter, der 1911 den Begriff der »schöpferischen Zerstörung« geprägt hat. Jede ökonomische Entwicklung baut im Kern auf einer Zerstörung von etwas Bestehendem auf – so seine Theorie, mit der er seiner Zeit voraus war. Gemeint ist die Zerstörung von alten Märkten durch neue Technologien, Produkten, Dienstleistungen, Methoden oder Geschäftsmodellen. Schumpeter war der Meinung, dass die schöpferische Zerstörung, auch »kreative Zerstörung« genannt, die Basis für Innovationen, Wachstum und Wohlstand ist. Erst das Neue macht radikale Veränderungen möglich. Unternehmen, aber auch wir Menschen streben Fortschritt, Entwicklung und Veränderung an, verfolgen dabei aber stets die Strategie der Stabilität und Planbarkeit. Was wir stattdessen brauchen ist die Fähigkeit des »think outside the box«-Denkens.
Schöpferische Zerstörung wichtiger denn je
Im Laufe der Jahrzehnte ist Schumpeters Theorie für Unternehmen immer relevanter geworden. »Innovation« wird heute in jeder Organisation großgeschrieben und genießt höchste Priorität. Viele Unternehmer haben erkannt, dass nicht die Unternehmensgröße die Stärke einer Unternehmung definiert, sondern die Fähigkeit, sich an stets ändernde Rahmenbedingungen anzupassen.
Wer die schöpferische Zerstörung nicht ernst nimmt, hat mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen. Um das zu verhindern, setzen viele Unternehmen (besonders in den Vereinigten Staaten) auf ein »keine Regeln-Konzept. Man hat hier erkannt, dass zu viele Regeln limitieren und Innovationen verhindern. Unternehmen greifen oftmals auf ein Change Management Coaching zurück, um dieses Limit zu brechen.
3 Beispiele der schöpferischen Zerstörung
Bei der von Joseph Schumpeter begründeten schöpferischen Zerstörung werden in der Regel alte Märkte zerstört und durch neue Technologien, Produkte oder Geschäftsmodelle ersetzt. Beispiele hierfür gibt es in unserer Geschichte unzählige. Die folgenden Drei sollen den Begriff »schöpferische Zerstörung« verdeutlichen.
Das Auto hat die Kutsche verdrängt
Digitale Bilder haben analoge Bilder ersetzt
Benzin und Dieselautos werden durch Elektroautos ersetzt
Apple und die schöpferische Zerstörung
Die schöpferische Zerstörung ist aus der Wirtschaftswelt nicht mehr weg zu denken. Was des einen Freud ist, ist des anderen Leid. Das musste auch schmerzlich das Erfolgsunternehmen Sony merken …
Ein Paradebeispiel für die schöpferische Zerstörung ist Sony. Die meisten von euch werden aus ihrer Kindheit noch den »Walkman« kennen. Für die neueren Generationen, die das Kultprodukt nicht kennen: Man konnte Musikkassetten in den Walkman einlegen und über Kopfhörer Musik hören. Was langweilig klingt, war in den 80er-Jahren eine Sensation. Sony hatte mit dem Produkt einen Welterfolg gelandet und dominierte den Markt zwanzig Jahre lang nach Strich und Faden.
Apple zerstörte den Markt
Bis Apple den Markt mit dem iPod betrat. Für Menschen, die iPods schon nicht mehr kennen, sei angemerkt, dass der kalifornische Computerhersteller bevor er den Handymarkt umkrempelte, zunächst den Markt für mobile Musikplayer auf den Kopf stellte. Anstatt mit der vorhandenen Marktmacht auf Apples Markteintritt im Jahre 2001 zu reagieren, erkannte Sony die Gefahr nicht und ließ Apple einfach machen. 2007 hatte Apple 100 Millionen iPods verkauft und faszinierte damit seine Kunden. Nicht nur die: Auch die Weltpresse, denn sie titulierte den iPod als den »Walkman des 21. Jahrhunderts«. Parallel zum iPod baute Apple sein Internetangebot für Musiksongs, den iTunes Store, aus und verzeichnete 2009 bereits einen Marktanteil von 70 Prozent am amerikanischen Musik-Downloadmarkt.
Sony legte Augenmerk auf die falschen Dinge
Es ist nicht so, dass Sony den Markt digitaler Musikplayer nicht erkannte, doch man hatte die falsche Strategie. Sony sah den Schlüssel zum Erfolg in der Hardware, während Apple erkannte, dass es die nutzerfreundliche Verknüpfung von Hard- und Software mit passenden Inhalten ist. Getrieben von schöpferischer Zerstörungskraft machte Apple aus einem guten Produkt ein überragendes Produkt: Verknüpfung zu iTunes bis hin zum Aufbau einer Lifestyle-Marke – der iPod wurde ein Welterfolg.
Wie funktioniert die schöpferische Zerstörung?
Keynote Speaker Change für Management und Business Rebell Markus Czerner über Regeln, Veränderung und die Macht der schöpferischen Zerstörung.
Schöpferische Zerstörung als disruptive Innovation
Stabilität durch stetige Weiterentwicklung
Was paradox klingt, ist in Wirklichkeit das Erfolgsgeheimnis der heutigen Zeit. So werden in den nächsten Jahren Elektroautos sukzessive Benziner ersetzen. Elon Musk hat mit Tesla vor vielen Jahren die schöpferische Zerstörung dieses Marktes in Gang gebracht, die nicht mehr aufzuhalten ist. Häufig verschwinden nicht nur bewährte Produkte am Markt, sondern deren Produzenten gleich mit. Einige wenige Unternehmen schaffen es, sich rechtzeitig an die neuen Marktbedingungen anzupassen, verlieren aber in der Regel ihre Vormachtstellung.
In Wirtschaftsunternehmen ist die schöpferische Zerstörung aktueller denn je. Ich habe es schon einmal gesagt: Viele Marktführer sind Künstler im Verwalten, nur geht das auf Dauer nicht gut. Das Verwaltende erstickt das Wertschaffende. Bestes Beispiel sind Reisebüros und Hotels, die in den letzten Jahren erhebliche Marktanteile einbüßen mussten, weil sie von kreativen Zerstörern wie Airbnb, die Privatunterkünfte über die eigene Plattform vermitteln, überrannt wurden.
Schöpferische Zerstörung eher bekannt als »disruptive Innovation«
In der Wirtschaftswelt wird selten über »schöpferische Zerstörung« gesprochen, dafür umso mehr über »Disruptive Innovation«.
Für das Wort »Disruptiv« gelten zahlreiche Übersetzungen, die alle in die gleiche Richtung gehen: Störung, Riss, Bruch, Zusammenbruch, Zerrüttung, um nur einige zu nennen. Im Prinzip verbirgt sich dahinter nichts anderes als die schöpferische Zerstörung.
Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Clayton Christensen hat beschrieben, wie solche disruptiven Veränderungen entstehen: Alle bahnbrechenden Technologiesprünge wurden von den führenden Unternehmen der jeweiligen Branchen verpasst. Für ihn sind es immer die kleinen und jungen Unternehmen, meistens Start-ups, die technologischen Fortschritt schaffen und veraltete Strukturen zerstören. So entstehen neue Märkte und neue Geschäftsmodelle.
Rulebreaker sind Protagonisten der schöpferischen Zerstörung
Regelbrecher, auch Rulebreaker genannt, die Märkte aufbrechen und die am Markt geltenden Spielregeln grundlegend verändern. So wie 1998 der damals 18-jährige Student Shawn Fanning: Er wollte Musikdateien im MP3-Format mit anderen austauschen und entwickelte eine Software, mit der Dateien direkt zwischen mehreren an das Internet angeschlossenen Computern ausgetauscht werden konnte. Er gründete die Internet-Plattform Napster und drehte die Musikbranche komplett auf den Kopf.
Christensen sieht den disruptiven Prozess als zwingend notwendig für eine funktionierende Weiterentwicklung des Marktes
Der Weg zur schöpferischen Zerstörung
Regeln sind hilfreich. Sie geben Struktur. Doch sie sind auch ein Hindernis für Kreativität und Innovation. Schlecht für Unternehmen die genau davon leben. Das Buch »Ignore the Rules« von Top Keynote Speaker und Bestseller-Autor Markus Czerner – ein Plädoyer für den kontrollierten Regelbruch.
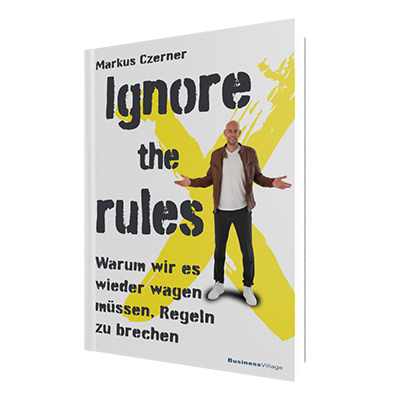
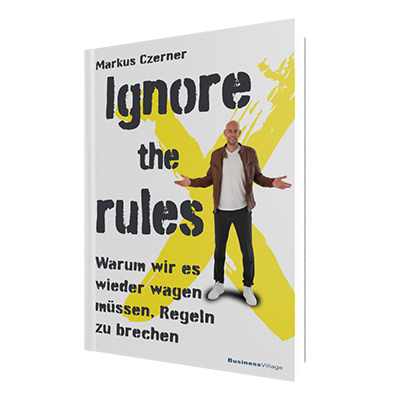
Die schöpferische Zerstörung und das eigene Leben
Es ist ein interessantes Gedankenspiel, die kreative Zerstörung (oder meinetwegen auch die disruptive Innovation) auf das eigene Leben zu transportieren. Doch was genau bedeutet das? Und sind die Auswirkungen genauso positiv, wie in der Wirtschaftswelt auch?
Rückschläge führen zu radikalen Veränderungen
So oft kommt es vor, dass Rückschläge zu radikalen Veränderungen führen, die unsere eigene Zukunft maßgeblich beeinflussen. Ob es die plötzliche Trennung vom Lebenspartner, die Kündigung des Arbeitgebers, die Insolvenz oder eine Erkrankung ist – ganz oft sind es Schlüsselmomente für die schöpferische Zerstörung, die radikale Veränderungen in Gang setzt. Zahlreiche Menschen hören nach einem Herzinfarkt von jetzt auf gleich mit dem Rauchen auf und schlagen einen gesunden Lebensstil ein. Das Leben wird umgekrempelt und man erfindet sich quasi neu. Ich sagte es bereits: Nach leidvollen Erfahrungen ist das Entwicklungspotenzial des Einzelnen am größten.
Jede Krise ist eine Chance
»Krise als Chance« heißt es so schön. Das ist nur deswegen zutreffend, weil uns Krisen häufig zur schöpferische Zerstörung zwingen, wollen wir sie denn überstehen. So haben sich zahlreiche Unternehmen während der Corona-Krise komplett neu erfunden, in dem sie Altes zerstört und Neues aufgebaut haben. Das sind zugleich die Unternehmen, die nach der Krise als Gewinner hervortreten.
Die große Herausforderung besteht darin, die kreative Zerstörung nicht nur während Krisen und in Momenten des Leids walten zu lassen, sondern schon in Zeiten des Erfolges. In guten bequemen Zeiten werden Veränderungen jedoch meist vermieden. Warum etwas ändern, wenn alles hervorragend läuft? Zudem bringen Veränderungen immer Risiken mit sich und das Grundbedürfnis nach Sicherheit genießt auch an der Stelle oberste Priorität.
Ist schöpferische Zerstörung ein Risiko?
Ob es Innovationen in Unternehmen oder neue Wege im persönlichen Leben sind: Sie gelten als risikoreich mit ungewissem Ausgang. Das sind sie zweifelsohne – aber ist es nicht weitaus risikoreicher, veraltete Dinge immer weiter zu optimieren?
Es wird stets versucht, Risiken zu minimieren oder sie gänzlich zu vermeiden.
Über den Autor: Top Keynote Speaker Markus Czerner
Markus Czerner gehört zu »einem der besten Vortragsredner im deutschsprachigen Raum« (Founders Magazin) und wird von Marktführern sowie Top Brands gebucht. Als Top Keynote Speaker für Motivation und Keynote Speaker für Resilienz begeistert er sein Publikum mit authentischen und mitreißenden Vorträgen zu den Themen Motivation, Resilienz, Change Management und positive Fehlerkultur. Mit seiner einzigartigen Art, komplexe Inhalte greifbar und inspirierend zu vermitteln, sorgt der Redner für nachhaltige Begeisterung und lässt seine Zuhörer nicht nur zuhören, sondern aktiv mitdenken und handeln.
Markus Czerner ist außerdem erfolgreicher Autor von sieben Büchern, von denen zwei auf die Bestseller-Listen gelangten. Das renommierte Erfolg Magazin zählt den Top Speaker zu den 500 bedeutendsten Persönlichkeiten der Erfolgswelt.
Seine eigene Reise, die ihn vom »No-Name« zu einem der erfolgreichsten Gastredner Deutschlands führte, zeigt, wie durch Durchhaltevermögen, Mut und eine klare Vision alles möglich ist. In seinem Speaker Training gibt der Motivationsredner und Business Coach nicht nur wertvolles Wissen weiter, sondern auch die praxisnahen Strategien, die er selbst genutzt hat, um als Top Redner und Unternehmer erfolgreich zu werden.


Erleben Sie Markus Czerner live und erfahren Sie, wie Sie Veränderungen erfolgreich gestalten.
Sie wollen für Ihre nächste Veranstaltung einen renommierten Redner buchen, der mit seiner Keynote Speech Ihr Publikum begeistert und nachhaltig inspiriert? Dann ist Markus Czerner genau Ihr Mann!
